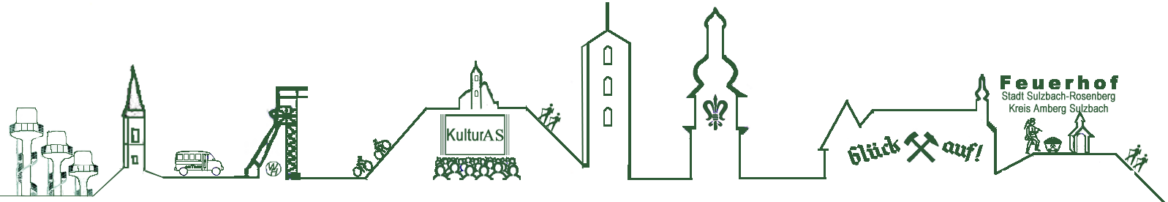Helmut Heinl Autorenseite
"Leben in der Bergmannssiedlung"
Aus alter Zeit; Bergbau um 1875
von Helmut Heinl
Das Erz im Eisenerzbergbau wurde seit Jahrhunderten vor allem mit Schlägel und Eisen abgebaut. (Beide Werkzeuge finden sich – mit den gekreuzten Stielen nach unten - seit dem 16. Jahrhundert im Bergmannswappen. Zeigen die Stiele nach oben ist der Bergbau geschlossen.) Hinzu kam die Spitzhaue, für weicheres Erz oder Gestein und natürlich die Schaufel.

Quelle: Wikipedia
Die Einführung von Presslufthammer und Pressluftbohrer, hat die Produktivität im Bergbau gravierend erhöht. In den Sulzbacher Gruben stand Pressluft ab 1914/15 zur Verfügung. Allerdings stieg damit auch der Druck auf die Bergleute nach einer höheren Erzproduktion. Der Pressluftbohrer war technisch einfacher und wurde vor dem Pickhammer (bei uns Picker genannt) eingeführt, natürlich zuerst in den Kohlengruben des Ruhrgebiets. Damit wurde zwar das Bohren der Schießlöcher beschleunigt, aber der Abbau erfolgte weiterhin von Hand. Es gab also keine wesentliche Produktionssteigerung. Die kam erst mit dem Pickhammer, der von den Bergleuten zunächst vehement abgelehnt wurde.
 Die Mittagspause dauerte 1 Stunde. Dazu kletterten die Kameraden über die eisernen Fahrten (Leitern) über Tage hinaus. Viele Bergleute bekamen von der Frau oder den Kindern ein warmes Essen gebracht, das dann, je nach Witterung, im Betriebsgebäude oder am Holzplatz verzehrt wurde. Nach der Brotzeit stieg die Mannschaft wieder über die Fahrten den Schacht hinunter und es ging zu Fuß wieder an das Abbauort. Dann traf man sich wieder an der Ortsbrust und richtete zum Schießen her. Der Ortsälteste wies an wo Sprenglöcher gebohrt wenden sollten. Gebohrt wurde mit dem Handbohrer, ca. 30-40 cm tief, wobei der Hauer und der Schlepper „der Junge“ abwechselnd bohrten. Der Hauer holte sich dann den nötigen Sprengstoff, während der Junge (Schlepper) noch weitere Löcher bohrte. Die Sprengpatronen wurden mit der Zündschnur versehen und mit dem Ladestock in die Löcher geschoben. Damit die Ladung nicht "auspfiff" wurden die Löcher mit Lehmnudeln gestopft.
Die Mittagspause dauerte 1 Stunde. Dazu kletterten die Kameraden über die eisernen Fahrten (Leitern) über Tage hinaus. Viele Bergleute bekamen von der Frau oder den Kindern ein warmes Essen gebracht, das dann, je nach Witterung, im Betriebsgebäude oder am Holzplatz verzehrt wurde. Nach der Brotzeit stieg die Mannschaft wieder über die Fahrten den Schacht hinunter und es ging zu Fuß wieder an das Abbauort. Dann traf man sich wieder an der Ortsbrust und richtete zum Schießen her. Der Ortsälteste wies an wo Sprenglöcher gebohrt wenden sollten. Gebohrt wurde mit dem Handbohrer, ca. 30-40 cm tief, wobei der Hauer und der Schlepper „der Junge“ abwechselnd bohrten. Der Hauer holte sich dann den nötigen Sprengstoff, während der Junge (Schlepper) noch weitere Löcher bohrte. Die Sprengpatronen wurden mit der Zündschnur versehen und mit dem Ladestock in die Löcher geschoben. Damit die Ladung nicht "auspfiff" wurden die Löcher mit Lehmnudeln gestopft.
Wie der Arbeitsablauf eines alten Bergmanns um etwa 1875 war, erzählte mir Obersteiger Ritter, so wie es ihm der alte Hermann aus Rummersricht erzählt hatte. Die „Hermänner“ waren seit mehreren Generationen im Bergbau.
Damals dauerte die Schicht noch 12 Stunden von 6:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Aus heutiger Sicht eine sehr lange Zeit. Um 6:00 Uhr stiegen die Bergleute ein, die jungen voraus, die alten hinten nach. Dann gingen sie vom Schacht zu Fuß, bis vor das Abbauort. Dort haben sich alle erst einmal hingesetzt und beratschlagt, was zu tun war.
Schließlich ging der Ortsälteste mit seinem Hauer und seinem Schlepper vor Ort. Dort wurde mit der Keilhaue ein paar Mal über die Ortsbrust "gekratzt", bis schließlich etwa eineinhalb Wagen Erz auf dem Boden lag. Der Schlepper bekam den Auftrag „so Bouwerl fass aa´“ worauf dieser den Wagen voll schaufelte. Dann schob er den Hunt, an den er vorne sein Geleucht angehängt hatte, ca. 70 – 90 m bis zum Erzbunker. Das ist die Stelle, wo das Erz ausgekippt wurde und kam mit dem zweiten leeren Wagen zurück. In den schaufelte er den Rest des Erzhaufens ein, während der Ortsälteste auf der Werkzeugkiste saß und im Schein seiner Ölfunzel das Sulzbacher Wochenblatt las. Das ist etwas, was man sich bei dem trüben Licht kaum vorstellen kann.
Als das Erz weggeschafft war meldete der Schlepper dem Hauer, dass kein Erz mehr vorhanden war, worauf Hauer und Ortsältester wieder zur Ortsbrust gingen und Erz abschlugen. Nachdem der Schlepper auch den zweiten Wagen gefüllt, weggefahren und wieder an das Ort zurückgebracht hatte, war Halb-Schicht, also 12 Uhr Mittag.
 Die Mittagspause dauerte 1 Stunde. Dazu kletterten die Kameraden über die eisernen Fahrten (Leitern) über Tage hinaus. Viele Bergleute bekamen von der Frau oder den Kindern ein warmes Essen gebracht, das dann, je nach Witterung, im Betriebsgebäude oder am Holzplatz verzehrt wurde. Nach der Brotzeit stieg die Mannschaft wieder über die Fahrten den Schacht hinunter und es ging zu Fuß wieder an das Abbauort. Dann traf man sich wieder an der Ortsbrust und richtete zum Schießen her. Der Ortsälteste wies an wo Sprenglöcher gebohrt wenden sollten. Gebohrt wurde mit dem Handbohrer, ca. 30-40 cm tief, wobei der Hauer und der Schlepper „der Junge“ abwechselnd bohrten. Der Hauer holte sich dann den nötigen Sprengstoff, während der Junge (Schlepper) noch weitere Löcher bohrte. Die Sprengpatronen wurden mit der Zündschnur versehen und mit dem Ladestock in die Löcher geschoben. Damit die Ladung nicht "auspfiff" wurden die Löcher mit Lehmnudeln gestopft.
Die Mittagspause dauerte 1 Stunde. Dazu kletterten die Kameraden über die eisernen Fahrten (Leitern) über Tage hinaus. Viele Bergleute bekamen von der Frau oder den Kindern ein warmes Essen gebracht, das dann, je nach Witterung, im Betriebsgebäude oder am Holzplatz verzehrt wurde. Nach der Brotzeit stieg die Mannschaft wieder über die Fahrten den Schacht hinunter und es ging zu Fuß wieder an das Abbauort. Dann traf man sich wieder an der Ortsbrust und richtete zum Schießen her. Der Ortsälteste wies an wo Sprenglöcher gebohrt wenden sollten. Gebohrt wurde mit dem Handbohrer, ca. 30-40 cm tief, wobei der Hauer und der Schlepper „der Junge“ abwechselnd bohrten. Der Hauer holte sich dann den nötigen Sprengstoff, während der Junge (Schlepper) noch weitere Löcher bohrte. Die Sprengpatronen wurden mit der Zündschnur versehen und mit dem Ladestock in die Löcher geschoben. Damit die Ladung nicht "auspfiff" wurden die Löcher mit Lehmnudeln gestopft.Gegen Schichtende, meistens eine halbe bis eine Stunde davor, wurde das Werkzeug weggeräumt und an einen sicheren Platz gebracht. Dann steckte der Ortsälteste mit der Flamme an seinem Geleucht die Lunten in Brand und alle zogen sich zurück. Die Sprengladungen explodierten, die Männer zählten die Schüsse, damit kein Blindgänger zurückblieb. Die Strecke füllte sich mit dichtem Rauch, die Schicht war zu Ende. Die Bergleute gingen wieder zu Fuß, in kleinen Gruppen, zum Schacht zurück und stiegen über die Fahrten nach über Tage. Hektik gab es da nicht. Im Betriebsgebäude wuschen sie sich und zogen meistens eine andere Kleidung an, besonders in den kalten Monaten. Die später üblichen Waschkauen gab es damals in Etzmannsberg noch nicht. Warmes Wasser war seit der Einführung der Dampfmaschine unbegrenzt vorhanden.
Auch wenn die Erzählung des alten Obersteigers den Eindruck vermittelt, es ging unter Tage relativ geruhsam zu. Man muss dazu die Lebensumstände kennen und berücksichtigen. Bei einer hohen Arbeitsbelastung wie heute, wäre eine zwölfstündige Schicht kaum durchzuhalten gewesen. Hinzu kam, dass die Bergleute zweimal die Fahrten (Leitern) im Schacht hoch kletterten, und das konnten bis zu 90 m sein, die jedes Mal senkrecht zurückgelegt werden mussten.
Außerdem waren viele Bergleute „Nebenerwerbslandwirte“, hatten zuhause "a kloins Zeigl", Ziegen, Schweine oder eine Kuh, die nach der Arbeit zu versorgen waren. Zur Selbstversorgung wurden im Garten Obst und Gemüse angebaut. Da halfen zwar Frau und Kinder kräftig mit, aber trotzdem blieb für den Mann einiges zu tun.
Dazu kam das Sägen des Brennholzes - natürlich mit der Hand. Da das von der Grube zur Verfügung gestellte Holz für die Bergleute meistens nicht ausreichte, ging die Familie zum Holz klauben. Wer die Erlaubnis zum „Kraglreissn“ hatte ging mit langen Stangen in den Wald, um damit dürre Äste herunter zu reißen. Das alles wäre unter der hohen Arbeitsbelastung Mitte des 20. Jahrhunderts sicher nicht mehr möglich gewesen.
Als der damals neue Bergwerksbetriebsleiter Hamacher seinen Dienst antrat regte er beim Direktorium der Maxhütte sofort an, die Schichtzeiten zu verkürzen. Ihm war klar, dass eine zwölfstündige Schicht zu lange war, um wirklich Leistung zu erbringen. Er konnte sich allerdings bei der Maxhüttenleitung nicht durchsetzen und es dauerte noch Jahrzehnte, bis von der 12 Stunden-Schicht auf die 8 Stunden-Schicht gewechselt wurde.
Die vermeintlich gute alte Zeit war deshalb gar nicht so geruhsam wie wir es uns heute gerne vorstellen. Vor allem für den ärmeren Teil der Bevölkerung war sie wegen der Kräftezehrenden Arbeit und der fehlenden sozialen Absicherung problematisch. Die gesetzliche Krankenversicherung gibt es erst seit 1883 und anfänglich waren nur 10 % der Beschäftigten pflichtversichert. Deshalb hatten die Bergleute, mit ihrer unfallträchtigen Arbeit, eine eigene, wenn auch knappe Absicherung in ihren Bruderschafts- und Knappschaftsvereinen.
©Helmut Heinl